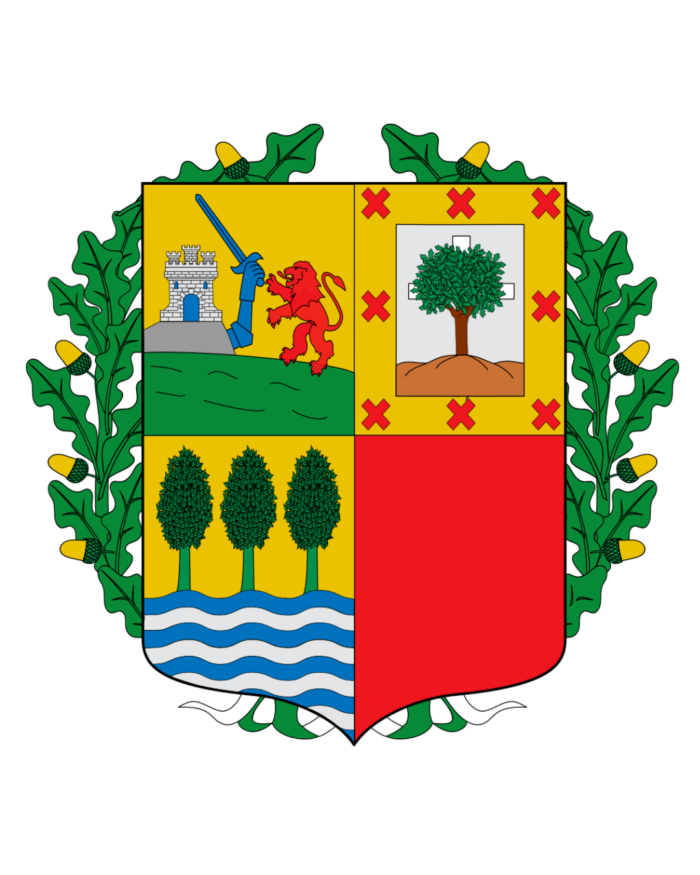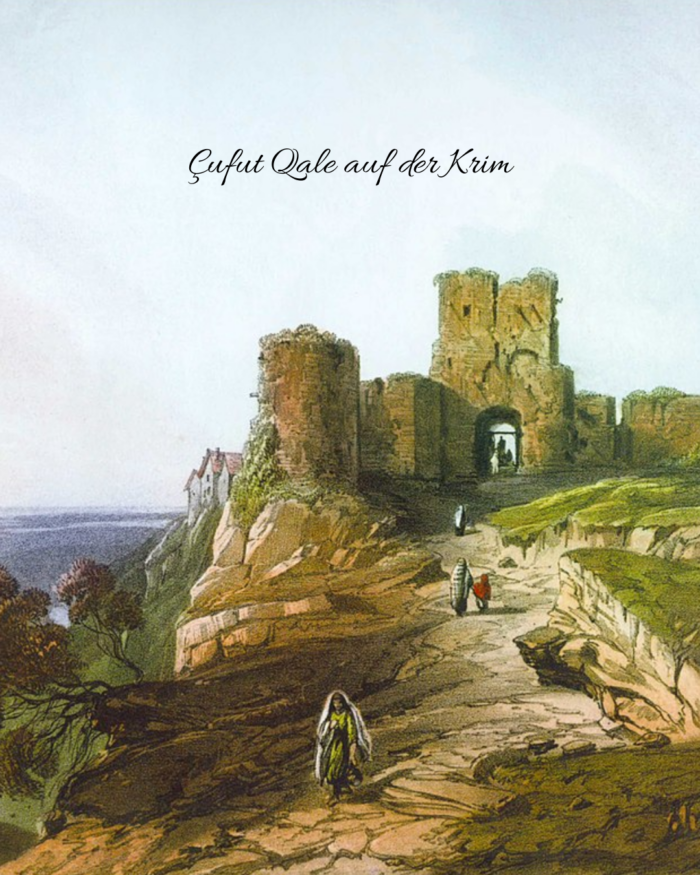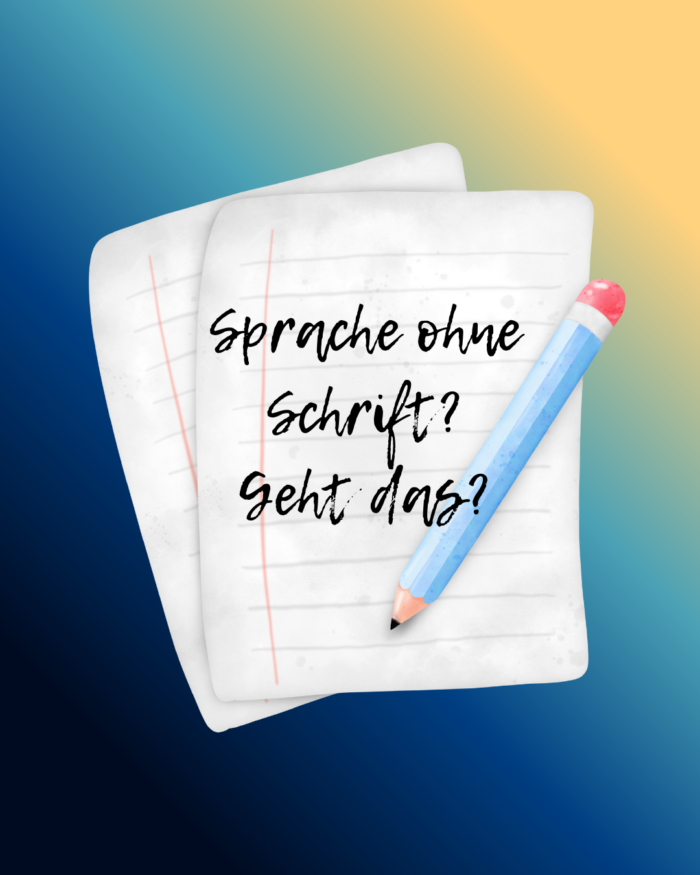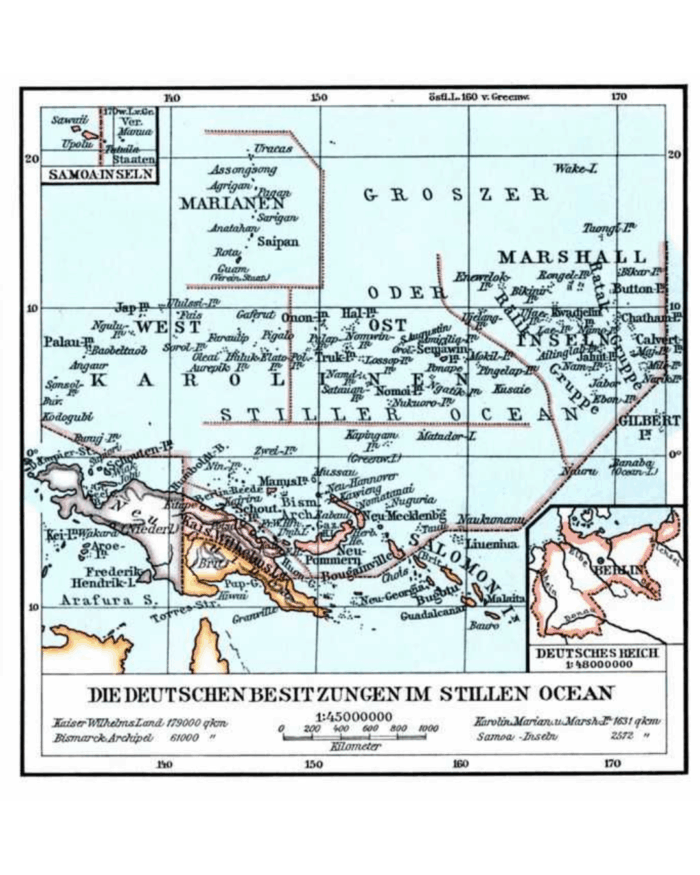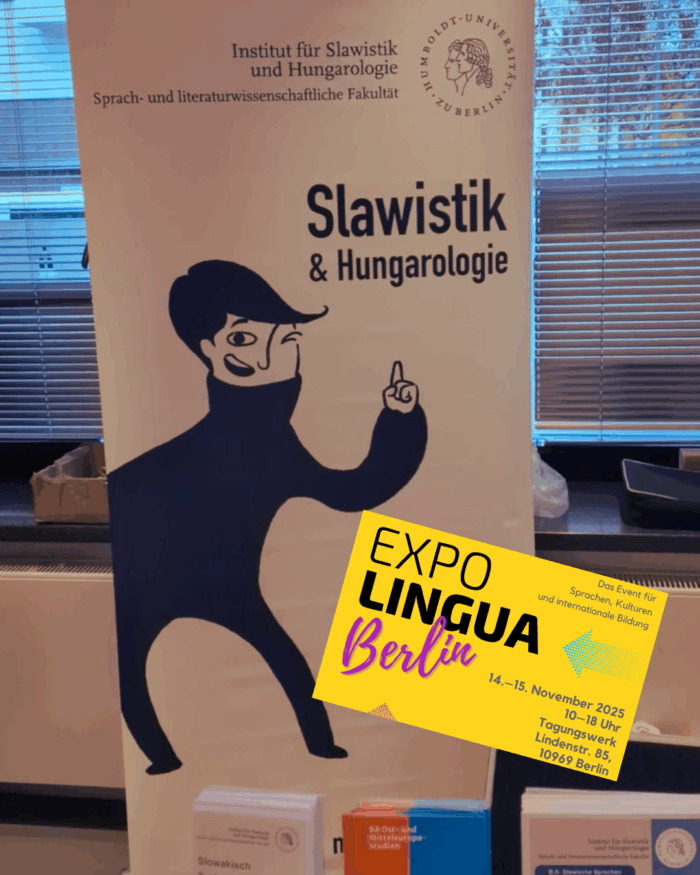In den letzten Jahren ist Sprache als Diskussions- und Streitthema immer mehr in den Vordergrund unserer Wahrnehmung gerückt. Dabei geht es um Fragen rund um die Sprachnutzung, den Sprachwandel oder auch neue Wörter im Deutschen. Dass die Diskussionen bei diesen Themen gerne ausarten und zu Streitigkeiten führen, zeigt sehr gut wie emotional Sprache sein kann.
Sprache geht uns alle etwas an, denn wir alle kommunizieren mit Sprache. Dass sich Sprachen unterscheiden, ist allen klar. Wenn sich innerhalb der eigenen Sprache Unterschiede zeigen, neigen wir dazu alles zu bewerten und vergessen oftmals wie individuell die Sprache jedes Einzelnen ist. Doch wer entscheidet darüber wie wir sprechen?
Eins vorweg: Jede Person darf so sprechen wie sie will. Es gibt niemanden, der uns irgendetwas vorschreiben kann! Aber es gibt gewisse gesellschaftliche und sprachliche Normen und im Laufe unseres Lebens lernen wir innerhalb des Bildungssystems meist die Standardsprache mit verschiedenen Registern. Was wir in diesem System nur teilweise lernen, ist der Umgang mit Sprache selbst.
Wie unsere Gesellschaft, ist auch unsere Sprache immer diverser geworden. Das gefällt nicht allen, ist aber Teil unserer Identität. Und genau hier beginnen dann die Konflikte in der Kommunikation. Da Sprache so divers ist, prallen oft verschiedene Sprachmuster und -einstellungen aufeinander. Viele Menschen empfinden neue Einflüsse oder ungewohnte Sprachstrukturen als unangenehm, ungewohnt oder sogar als störend.
Ein prominentes Beispiel ist das „Gendern“. Kaum ein anderes Thema erhitzt die Gemüter so sehr wie der Versuch die Sprache inklusiver und diverser zu gestalten. Es geht so weit, dass es in einigen deutschen Bundesländern, u.a. Hessen, sogar Verbote in Schulen gegen Formen wie Lehrer*innen oder Ärzt:innen gibt. Die Argumentation für die Einführung dieses Verbots ist weder pädagogisch noch linguistisch sinnvoll, sondern eine Machtdemonstration. Das „Genderverbot“ gilt z.B. an allen Schulen der Region, hingegen gab es nie eine Pflicht zum „Gendern“, wie von vielen immer angenommen. Die Bestrebung durch inklusive Sprache bzw. „Gendern“ die Gleichstellung innerhalb der Gesellschaft zu fördern, scheint vielen ein Dorn im Auge zu sein.
Ähnlich gespalten ist die Sprecher*innengemeinschaft auch bei Abbau von rassistischer oder anderer diskriminierender Sprache. Das Argument „Früher hat es auch keinen gestört.“ ist dabei ein Klassiker der Verdrängung sozialer Ungleichheiten, die früher schon gestört haben, jedoch nicht im Fokus der Gesellschaft standen.
Die Freiheit so zu sprechen und zu schreiben wie wir wollen, sind durch bestimmte Kontexte wie Sprachverbote in einigen Regionen also Grenzen gesetzt, die sich aber nur auf öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Behörden begrenzen. Außerhalb dieser Einrichtungen sollte jede*r so kommunizieren wie es das persönliche Empfinden verlangt.
In vielen Situationen haben sich sprachliche Elemente, die Inklusion auf sprachlicher Ebene sichtbar machen, schon positiv verändert, weil ihre Nutzung ein Bewusstsein schafft und die Akzeptanz vergrößert. Das bedeutet aber nicht automatisch einen Zwang für alle sich anpassen und anders sprechen zu müssen!
Sprache ist und bleibt im Wandel. Wir schaffen uns die Wirklichkeit, indem wir unser sprachliches Handeln reflektieren. Verbote werden daran nichts ändern können, zeigen sie doch nur wie sehr einige Menschen Angst haben Toleranz und Diskriminierungsfreiheit zu versprachlichen!