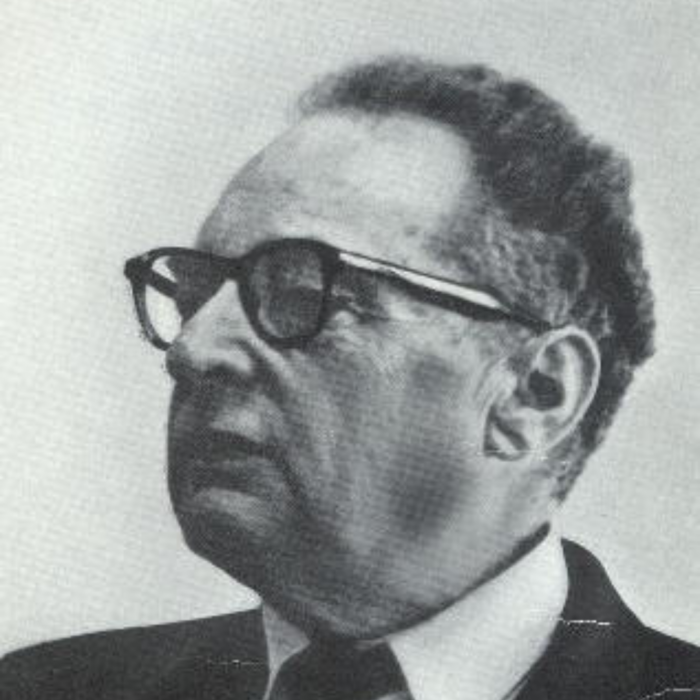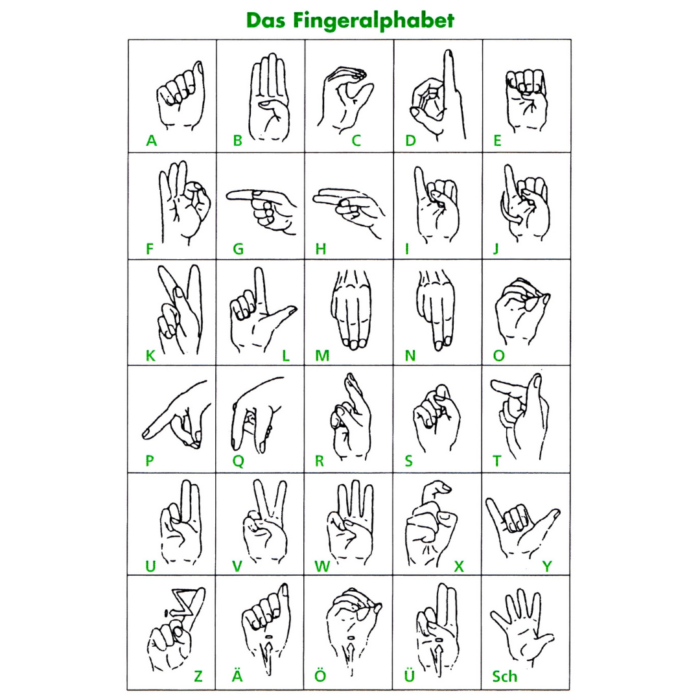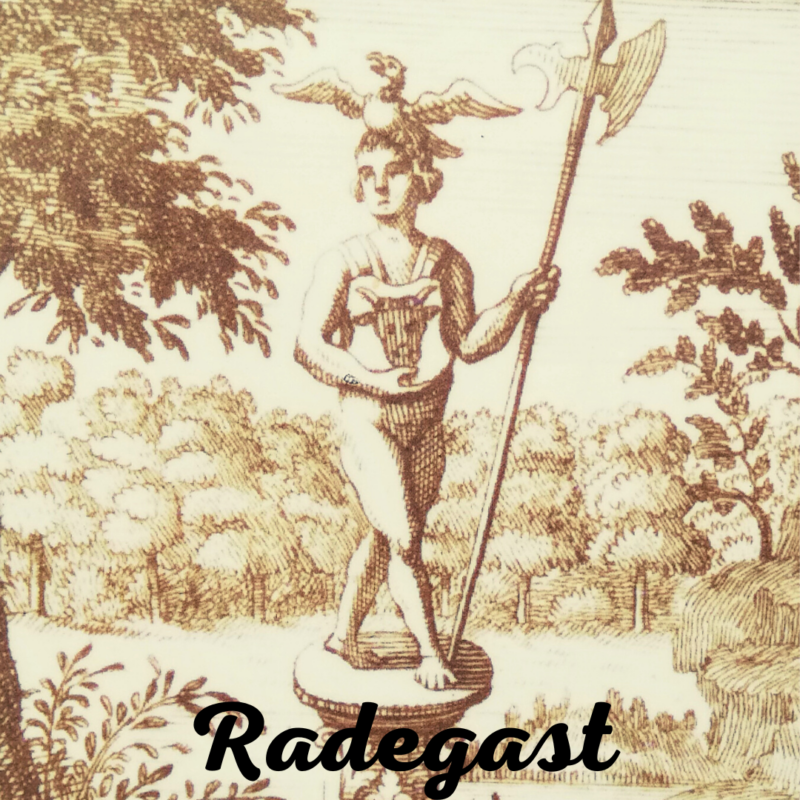„Fernes nahes Land“- die Definition des Journalisten Klaus Bednarz beschreibt die Region Ostpreußen treffend. Mit ihr verbindet man Geschichte und Mythos, den Deutschen Orden mit der Marienburg, die Christianisierung der Prußen, den Aufstiegs Preußens und die Zeit des Nationalsozialismus mit Bunkeranlagen u.v.m.
Ostpreußens Geschichte reicht weiter zurück als der Begriff ‚Ostpreußen‘, der eher ein politischer ist, vermuten lässt. Das Gebiet reicht von der Ostsee im Norden, Höhe der Weichselmündung, bis zur Memel, einschließlich des Teils des heutigen russischen Oblast Kaliningrad, bis zur südlichen Grenze der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen.
Die ursprünglichen Besiedler Ostpreußens waren die Prußen, ein baltischer Volksstamm, von dem auch der Name ‚Preußen‘ abgeleitet ist. Im 9. Jahrhundert wurden die Prußen erstmals gesichert in Aufzeichnungen erwähnt als die ersten Missionierungsversuche begannen. Frühere Erwähnungen zu Römerzeiten können nicht 100%ig bestätigt werden. Richtig wichtig wurde das Gebiet erst als der Deutsche Orden 1226 vom Herzog Konrad von Masowien gebeten wurde ihm, wegen der räuberischen Überfälle der Prußen in sein Territorium, zu helfen. Außerdem sollte die Christianisierung des baltischen Stammes angestrebt werden, die als einer der letzten an ihrem alten Glauben festhielten. Als Gegenleistung für die Dienste bekam der Deutsche Orden die Gelegenheit sich als lokale Machthaber in der Region zu etablieren, was sich vor allen in den prächtigen Bauten wie der Marienburg noch heute ablesen lässt. Doch das anfänglich kleine Herrschaftsgebiet des Ordens wuchs schnell, sie gründetet u.a. Thorn und Kulm (polnisch Toruń und Chełmno). Ihr wachsender Einfluss in der Region war den umliegenden Herrschern ein Dorn im Auge. Die Folge waren mehrere Kriege z.B. die Schlacht von Tannenberg 1410 und der Dreizehnjährige Krieg zwischen dem Orden und Polen, die zur Schwächung des Ordens führten. Der letzte Hochmeister Albrecht von Brandenburg wandelte den Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum, unter der Krone Polens, um. Vor allem die Reformation und der Glaubenswechsel des Hochmeisters sicherte dem „neuen“ preußischen Staat die Existenz und legten den Grundstein für die Entstehung des späteren Königreiches Preußen.
Als Teil Preußens erfuhr die Region Ostpreußen zahlreiche Reformen, religiösen, sozialer und verwaltungstechnischer. Die Bevölkerung war multiethnisch, nicht nur Nachkommen der Prußen, sondern auch deutsche Siedler, Polen und Litauer lebten dort, meist friedlich zusammen. Die Hauptstadt der Region, Königsberg, war das kulturelle Zentrum und der Sitz der 1544 gegründeten Albertus-Universität. Zahlreiche Gelehrte, zwei der bekanntesten sind Immanuel Kant und Johann Gottfried Herder, machten die Universität bekannt.
Die Stärke und die Dominanz des preußischen Staates verlor sich durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Der Friedensvertrag von Versailles 1919, trennte Ostpreußen vom restlichen Deutschland, da die Siegermächte den polnischen Staat nach 123 Jahren der Teilung (an der Preußen maßgeblich beteiligt war) wieder entstehen ließen. Diese Trennung Ostpreußens sorgte bei den Deutschen für Missstimmung. Die Nationalsozialisten vereinten durch ihren Überfall auf Polen das Gebiet wieder mit Deutschland bzw. sie verleibten sich Polen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Ostpreußen teilweise an Polen und als Exklave an die Sowjetunion. Die Vertreibung der restlichen deutschstämmigen Bevölkerung ist eins der noch nicht aufgearbeiteten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das politische Klima der letzten Jahrzehnte ermöglichen erst allmählich Rekonstruktionen der damaligen Ereignisse. Die Politik der beiden deutschen Staaten bzw. der heutigen Bundesrepublik erkennt die Grenzen, die damals festgelegt worden sind, uneingeschränkt an. Das bedeutet für viele ehemalige Bewohner und ihre Nachkommen, dass das Ostpreußen von damals Geschichte ist und bleiben wird.
Trotz der politisch eindeutigen Lage Ostpreußens, symbolisiert es als Region doch eine Faszination und ein Heimatgefühl für viele Deutsche. Seit dem Ende des Kalten Krieges reisen viele Deutsche in das Gebiet ihrer Vorfahren, besuchen ihre Heimatdörfer, versuchen Informationen aus den Archiven zu sammeln. Es ist eine unendliche Schatzsuche, die eigene Geschichte so eng verwoben mit dieser Region, deren Reiz bei den Jüngeren eher in Gestalt der Landschaft und der Natur liegt.
Ähnlich wie in Schlesien finden sich auch in Ostpreußen ein kultureller, vor allem literarischer Schatz. Die Regionalliteratur Ostpreußens beweist die Verwurzelung der ehemaligen und neuen Bewohner (viele Polen aus den Kresy, den polnischen Ostgebieten, die Polen nach dem Krieg an die Sowjetunion verlor, wurde u.a. nach Ostpreußen umgesiedelt), die alle das Schicksal der Vertreibung teilten. Zwei bekannte Vertreter*innen der ostpreußischen Kultur sind der Schriftsteller Siegfried Lenz und die Malerin Erika Durban-Hofmann.
Quelle
Kossert, Andreas. Ostpreußen. Geschichte und Mythos. Siedler, München 2005
Pölking, Hermann. Ostpreußen – Biographie einer Provinz. Be.bra-Verlag, Berlin 2011
Bildquelle
By Wappen der ehemaligen preußischen Provinz Ostpreußen, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40584865