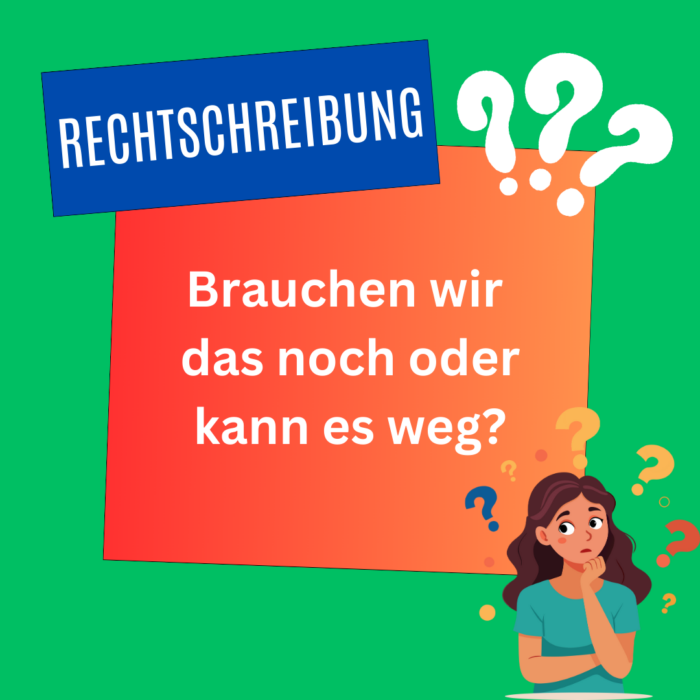
Diktate prägten mein ganzes Schulleben, bis zur zehnten Klasse. Vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch daran erinnern. Ich erinnere mich gut an die Anspannung an den Diktattagen, für die ich fleißig geübt habe. Meine Lehrerin in der achten Klasse hat mir nach einer Diktatrückgabe gesagt, dass ich wohl viel lesen würde, weil ich die deutsche Rechtschreibung so gut beherrsche. Diesen Tipp gebe ich auch meinen Kindern. Lest mehr, dann prägt ihr euch die Schreibung schwieriger Wörter von ganz alleine ein!
Aber was würde denn eigentlich passieren, wenn man beim Schreiben nicht auf die Rechtschreibung achten würde? Ist es verboten so zu schreiben, wie man will? Theoretisch kann jede Person schreiben, wie sie will. Es gibt kein Gesetz, das verbietet nach Gehör zu schreiben. In der Schule riskiert man halt eine schlechte Deutschnote, aber das wars. Auf Ämtern ist die Schreibfreiheit allerdings auch begrenzt. Auch hier ist die Verwendung einer festgelegten Schreibung des Standarddeutschen vorgeschrieben.
Also kurz um, wir kommen kaum umher richtig zu schreiben. Doch wer hat das eigentlich beschlossen wie wir zu schreiben haben? Dafür müssen wir zu den Anfängen des Deutschen als Schriftsprache zurückgehen. Die ersten Texte in deutscher Sprache wurden wahrscheinlich im 8. Jahrhundert geschrieben, mit lateinischer Schrift. Schon hier traten die ersten Schwierigkeiten auf, denn das lateinische Alphabet konnte nicht alle Laute des damaligen Deutsch verschriftlichen. Es mussten Abwandlungen der Buchstaben wie z.B. die Umlaute her. Auch Großschreibung oder Satzzeichen sind nötig, um Satzanfänge und -enden zu markieren. Ein Vorreiter in dieser Sache war Notker von St. Gallen, der eine erste Schreibung festlegte. Trotzdem schrieben die meisten frei nach Schnauze.
Selbst als der Buchdruck ab 1450 aufkam, entstand keine einheitliche Schreibung, weder Groß- und Kleinschreibung noch die Schreibung von Doppelkonsonanten etc. Da auch das Deutsche als Sprache so große Veränderungen durchgemacht hat, besonders in der Silbenstruktur und im Vokalsystem, und die Mehrheit der Menschen im Mittelalter eh nicht lesen und schreiben konnten, betraf die Frage nach einer einheitlichen Schreibung nur eine kleine Gruppe in der Bevölkerung.
Bewegung in die Sache kam erst ab dem 18. Jahrhundert. In der Zeit nahm u.a. die Schulbildung der Menschen zu, d.h. immer mehr Menschen lernten lesen und schreiben. Das erforderte zuverlässige Lehrmaterialien und eine Ausbildung von Lehrern, die einen vergleichbaren Standard vermitteln sollten. Ein erstes nennenswertes Werk war das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm, begonnen um 1838 und erst seit einigen Jahren fertiggestellt. Ihre Arbeit verstärkte die Diskussion um eine genormte Rechtschreibung für Schulen und Behörden, die nach der Reichsgründung 1871 stetig vorangetrieben wurden.
Der Durchbruch in dieser Debatte konnte Konrad Duden verzeichnen, der 1880 sein Wörterbuch herausgab. Dudens Name ist bis heute ein Symbol für die deutsche Rechtschreibung. 1902 wurde Dudens Wörterbuch und die darin festgeschriebenen Schreibungen als Regelwerk bestätigt. Bis heute wird der Duden stetig überarbeitet, angepasst und neu herausgegeben, teilweise sind die Änderungen kontraintuitiv für die Menschen.
Bis heute musste Generationen von Schüler*innen zahlreiche Rechtschreibreform durchleben. Kaum hatte man das System durchschaut, kam die nächste Reform um die Ecke. Schrift ist wie Sprache an sich kein statisches Gebilde, sondern verändert sich mit dem Wandel der Sprache.
Besonders der Schrifterwerb kollidiert oftmals mit den Regeln der deutschen Rechtschreibung. Das Konzept ‚Schreiben wie gehört‘ funktioniert im Deutschen nicht, weil die deutsche Schreibung nicht phonetisch ist, d.h. ein Buchstabe repräsentiert mehrere Laute. Das erschwert das intuitive Schreiben. Da heißt es einfach üben, leider.
Doch wenn die deutsche Rechtschreibung so schwierig und wenig intuitiv ist, warum machen wir das überhaupt? Weil wir in einer Gemeinschaft leben, die bestimmte Regeln braucht, um zu funktionieren. Wir haben uns auf bestimmte Normen geeinigt, die im öffentlichen Leben gelten. Heute steht die deutsche Rechtschreibung ein wenig für deutsche Ordnung und gute Bildung, was im Umkehrschluss nicht heißt, dass Fehler in der Rechtschreibung unbedingt auf eine schlechte Bildung des Schreibenden deutet.
Aber im Privaten dürfen alle schreiben, wie sie wollen. Manchmal nutzen Personen eine offiziell falsche Schreibung, um Statements zu setzen oder eine Kunstform zu kreieren. Besonders in den Sozialen Medien kann man die verschiedensten Schreibungen finden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Quellen
Schneider, Michael. Geschichte der deutschen Orthographie – unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung seit 1994
Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Amtliche Regelung, 1. August 2006. Herausgegeben vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Narr, Tübingen 2006
